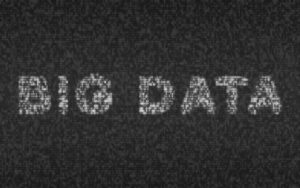In den vergangenen Wochen wurden wir wieder öfters mit der Frage konfrontiert, wie man mit chinesisch, oder iranisch stämmigen Bewerber:innen im Recruitment-Prozess umgehen soll. Eine aus unserer Sicht berechtigte Frage, jedoch ist oftmals der Ansatz zur Lösung des Problems der falsche. Näheres wird in weiterer Folge erörtert werden. Wir wollen uns in diesem Beitrag mit dem Nationalen Nachrichtendienstgesetz Chinas befassen und dies aus formaler Sicht beleuchten.
Seit Inkrafttreten im Juni 2017 steht Chinas Nationales Nachrichtendienstgesetz (NDG) zunehmend im Fokus der internationalen Diskussion. In Deutschland und Österreich sorgen die im Gesetz verankerten Verpflichtungen zur Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Unternehmen und den chinesischen Geheimdiensten oftmals für Besorgnis und Bedenken. Insbesondere Artikel 7 des NDG wird oft als Hinweis darauf betrachtet, dass chinesische Staatsbürger:innen oder Unternehmen zur Spionage im Ausland verpflichtet werden könnten.
Inhalte des Nationalen Nachrichtendienstgesetzes
Das NDG fordert von chinesischen Bürgern und Organisationen, „die Bemühungen des nationalen Nachrichtendienstes zu unterstützen, zu fördern und mit ihm zusammenzuarbeiten. Diese Regelung hat dazu geführt, dass chinesische Firmen im Ausland oft misstrauisch betrachtet werden. Die Angst besteht, dass China potenziell in der Lage ist, auch im Ausland tätige Unternehmen oder chinesische Staatsbürger zur Preisgabe sensibler Informationen zu drängen, selbst wenn diese Informationen unter anderem durch Handelsgeheimnisse geschützt sein sollten.
Allerdings enthält das NDG keine konkreten Durchsetzungsmechanismen für den Fall einer Verweigerung der Zusammenarbeit. Auch sind keine spezifischen Sanktionen vorgesehen, außer bei „Behinderung“ der nachrichtendienstlichen Arbeit. Dies hat zu Diskussionen darüber geführt, ob das Gesetz tatsächlich die Spionagegefahr durch chinesische Unternehmen erhöht oder lediglich eine symbolische Formulierung ist, die dem Staat mehr Macht verleiht, ohne diese regelmäßig anzuwenden.
Reaktionen in Deutschland und Österreich
Im Unterschied zu den Vereinigten Staaten, wo Visa für chinesische Staatsangehörige oft mit Hinweis auf das Risiko der Spionage verweigert werden, sind in Deutschland und Österreich bisher keine solch restriktiven Regelungen etabliert worden. Auch die EU-Gesetzgebung verfolgt bislang keinen vergleichbaren Ansatz wie die USA oder Kanada, die chinesische Studierende mit Verdacht auf potenzielle Spionage abweisen können. Die Entscheidung, Visa für chinesische Studierende und Forscher restriktiver zu gestalten, bleibt in Europa bislang eine Ausnahme.
Dennoch wächst auch in Deutschland und Österreich das Misstrauen gegenüber chinesischen Unternehmen, Studierenden und Mitarbeiter:innen in sensiblen Forschungsbereichen, insbesondere in den Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Deutsche Behörden erkennen an, dass eine pauschale Ablehnung chinesischer Staatsangehöriger mit Bezug zu sicherheitsrelevanten Technologien langfristige Nachteile für die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Innovationskraft nach sich ziehen könnte. Dabei stehen wirtschaftliche Interessen in einem Spannungsfeld mit Sicherheitsbedenken: Viele hochqualifizierte chinesische Fachkräfte tragen maßgeblich zur Wirtschaft in Deutschland und Österreich bei, sei es in der Forschung oder durch Arbeitsplätze in Technologieunternehmen.
Wirtschaftliche und politische Auswirkungen
Eine Überreaktion in Form von Visabeschränkungen für chinesische Studierende oder Forscher könnte potenziell die Attraktivität Deutschlands und Österreichs als internationale Bildungsstandorte gefährden. Die finanziellen Verluste, die durch den Rückgang internationaler Studierender entstehen, sowie die Einbußen bei Patentanmeldungen und hochqualifizierten Arbeitskräften könnten langfristig problematisch werden.
Das NDG, zusammen mit der Wahrnehmung Chinas als Bedrohung für die nationale Sicherheit, könnte dennoch zu schärferen Überwachungs- und Einwanderungsmaßnahmen führen. Eine klare und individuell ausgerichtete Risikobewertung wird dabei immer wichtiger, um das Risiko realistisch einschätzen zu können und nicht vorschnell auf Basis von Nationalität oder Universitätszugehörigkeit zu handeln.
Fazit: Balance zwischen Sicherheit und Kooperation
Die Abwägung von Risiken und wirtschaftlichen Interessen wird in Deutschland und Österreich von entscheidender Bedeutung sein. Während die USA und Kanada ihren Umgang mit chinesischen Staatsangehörigen verschärft haben, setzt Europa bisher auf eine ausgewogene Herangehensweise. Eine individuelle Risikoeinschätzung anstelle pauschaler Beschränkungen könnte eine nachhaltige Lösung sein, die die Sicherheitsinteressen wahrt, ohne die internationalen Bildungs- und Wirtschaftsbeziehungen unnötig zu belasten. Dazu möchten wir in einem weiteren Beitrag näher eingehen.
In einer zunehmend globalisierten Welt ist es wichtig, dass Deutschland und Österreich sicherheitspolitische Maßnahmen ergreifen, die eine differenzierte und realistische Bewertung der Risiken ermöglichen. Eine Überreaktion könnte das Vertrauen in die Wissenschaft und Wirtschaft schwächen und den Zugang zu Talenten behindern, die bisher wesentlich zum Erfolg europäischer Unternehmen beigetragen haben.
Literaturliste
Chinalawtranslate. (n.d.). What the National Intelligence Law says and why it doesn’t matter. Retrieved from https://www.chinalawtranslate.com
Gilli, A., & Gilli, M. (2021). The origins of dual-use technology: The case of the U.S. and China in a globalized world. Journal of Strategic Studies, 44(1), 86-108. https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1834076
Hanemann, T., & Huotari, M. (2020). Chinese FDI in Europe in 2019: The end of a golden era? Merics European Think Tank. Retrieved from https://www.merics.org
Lange, S. (2020). China’s foreign intelligence law and its implications for EU countries. In T. Altmann (Ed.), Emerging threats in the 21st century: Strategic insights for policymakers (pp. 44-62). Springer.
Ma, D., & McKern, B. (2020). China’s next strategic advantage: From imitation to innovation. MIT Press.
Oertel, J., & Sorace, M. (2019). Strategic patience: The EU’s response to China’s geopolitical rise. European Council on Foreign Relations (ECFR). Retrieved from https://www.ecfr.eu
Schmidt, A. (2018). Risks and opportunities of Chinese students and scientists in Europe. European Policy Center. Retrieved from https://www.epc.eu
Vollmer, H. (2021). Intelligence cooperation: The response of Germany and Austria to China’s National Intelligence Law. Intelligence and National Security, 36(2), 208-225.
Zenglein, M. J., & Holzmann, A. (2019). Evolving Made in China 2025: China’s industrial policy in the quest for global tech leadership. Mercator Institute for China Studies. Retrieved from https://www.merics.org
Autor: Dr. E. Gemeiner ist Anwalt und CEO der TRIAS Solutions GmbH, im Rahmen seiner juristischen Tätigkeit berät und unterstützt er Klient:innen bei der Umsetzung und Etablierung von Sicherheitsmaßnahmen. Der Aspekt Rechtssicherheit wird durch die Tätigkeiten von Dr. Gemeiner gewährleistet.